
Im Leben nebenan
August 22, 2025
Kreativ Schreiben. Handwerk und Technik des Erzählens
September 24, 2025
Im Leben nebenan
August 22, 2025
Kreativ Schreiben. Handwerk und Technik des Erzählens
September 24, 2025Buch des Monats
Die Assistentin
Caroline Wahl
Der neue Roman von Caroline Wahl zeigt mit präziser Bitterkeit, wie ein ganzes Unternehmen Machtmissbrauch toleriert, befördert, provoziert. „Die Assistentin“ zwingt jede und jeden zur Positionierung – ohne Moralkeule.
Rezension von Luisa Gehnen
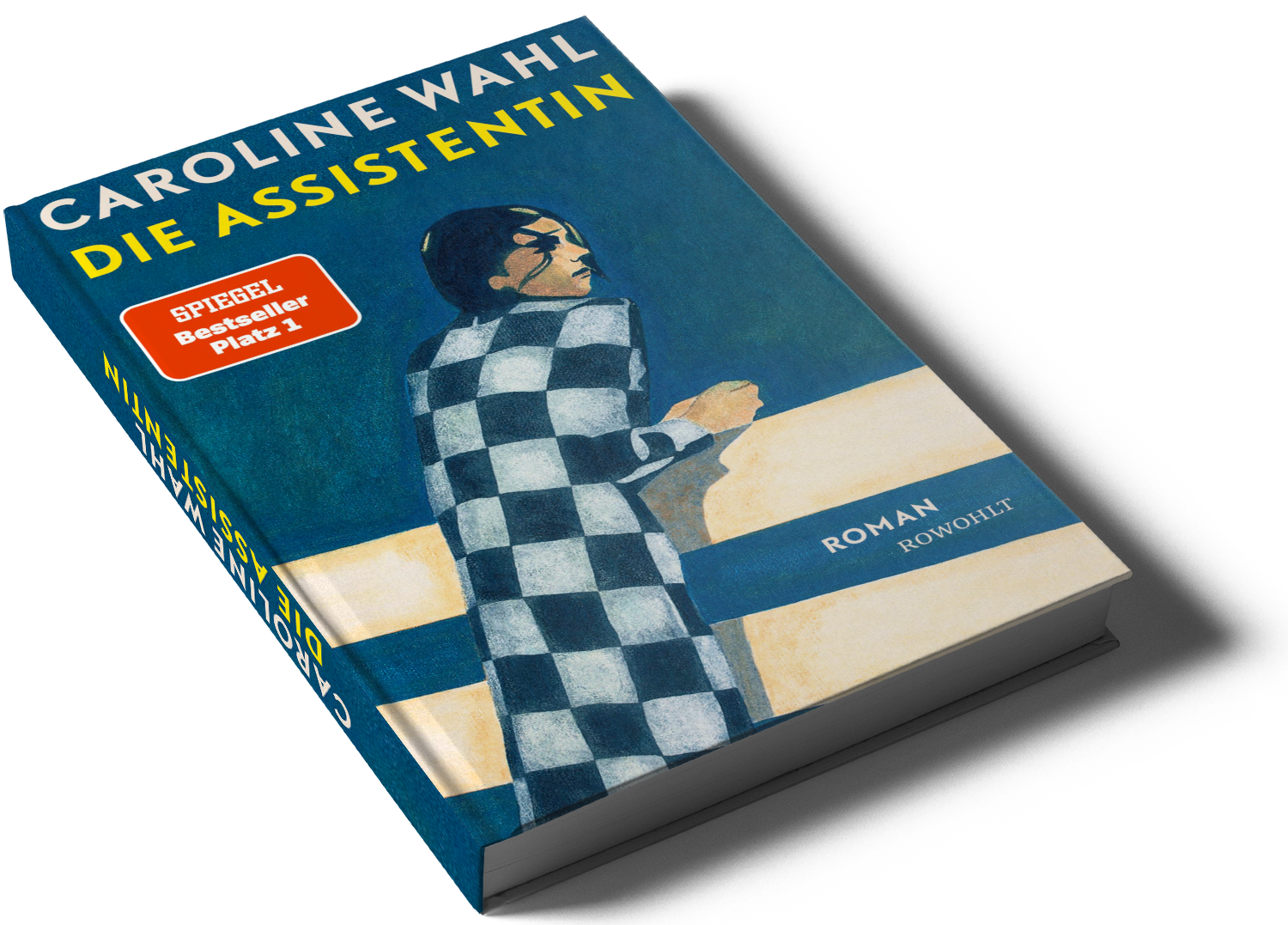
Eine junge Frau, ein glänzender Verlag, die Verheißung von Bedeutung – und ein System, das davon lebt, dass Grenzen immer überschritten werden. „Die Assistentin“ ist ein Roman über Machtmissbrauch, über die feinen Risse im Selbstwert, über Eltern, die zu sehr prägen, und Chefs, die alles nehmen. Und irgendwann fällt der Satz, der wie ein Signalton durch das ganze Buch hallt: „Aber es spielte keine Rolle, was sie wollte.“
Natürlich lässt sich „Die Assistentin“ nicht lesen, ohne die Debatte um Caroline Wahl mitzudenken. Nach zwei Bestsellern („22 Bahnen“, „Windstärke 17“) bekommt sie nun von vielen Seiten, auch von vielen Frauen, zu hören – aber was genau eigentlich? Kritisiert wird ihr Aussehen, ihr Auftreten, ihr Auto – das kann man schnell als Sexismus abtun. Denn die Welt mag keine erfolgreichen jungen Frauen.
Literarisch wird kritisiert, dass sie aus privilegierten Verhältnissen kommt und über Armut schreibt – und damit Erfolg hat. Mal davon abgesehen, dass sie in „Die Assistentin“ soziologisch eigentlich in ihrer Liga bleibt und autofiktional schreibt – was ist das für ein seltsamer Literaturbegriff? Ein Großteil der Weltliteratur lebt davon, dass Autor:innen in gesellschaftliche Nischen leuchten, in denen sie nicht groß geworden sind. Viel relevanter ist doch die Frage: Wie schreibt jemand aus wohlhabendem Hause über Armut, ohne Klischees zu reproduzieren oder aus Distanz Kapital zu schlagen?
Aber der Reihe nach.
Charlotte kommt nach München, um in „dem Haus“ als Assistentin zu arbeiten, dort, „ganz oben“, wie die Eltern es nennen. Ihr neuer Chef, der Verleger Ugo Maise (genannt mu) ist prominent, sprunghaft, bewundert. Der neue Job liest sich auf dem Papier wie eine große Chance, aber ist eine "riesengroße Fehlentscheidung".
Denn Charlotte gerät in ein System aus Regeln, Launen und Durchlässigkeit, in dem private Fragen ins Berufliche sickern, zufällige Berührungen nicht mehr zufällig sind und sie Tag und Nacht auf Abruf ist: “Der Verleger musste sich dabei umsorgt, ernst genommen und bewundert fühlen.“
Caroline Wahl seziert den Machtmissbrauch nicht im großen Skandalton, sondern mit präziser Bitterkeit: der Verleger will alles ganz konform nach dem Manuel Maise-Handbuch (aka. Charlottes neue Bibel): den WMF-Löffel (nicht den von IKEA), die Nudelsuppe ohne Nudeln, 67° Espresso – alles Requisiten eines Machtspiels, das davon lebt, dass niemand „Stopp“ sagt.
Charlotte weiß, was passiert und bleibt doch. Weil Lob wie Zucker ist. Weil die Mutter sagt, was der Vater sagt. Weil „ganz oben“ ein Versprechen ist, das nie eingelöst wird. Und weil Charlotte bleibt, fühlt sie, dass sie mitschuldig wird. Die Leute im Verlag machen sich mitschuldig, durch Schweigen – die Weihnachtsfeier, die Praktikantin, niemand geht dazwischen. Niemand greift ein, auch sie selbst nicht. Die bittere Erkenntnis: Missbrauch funktioniert nur, weil alle mitspielen. Charlotte ist Teil des Problems – und gerade das macht die Figur so real.
Wahl zeigt diese Komplizenschaft ohne moralische Belehrung. Nur durch Szenen, in denen man merkt, wie Normalität kippt und wie es immer unangenehmer wird. Und sie lässt auch Charlotte nicht als Heilige davonkommen: Konkurrenz, Mitläufertum, kleine Verrate – auch das gehört zur Wahrheit. Das ist hart zu lesen: Machtmissbrauch funktioniert nicht nur von oben nach unten, er braucht auch das Wegsehen der Leute von unten.
Wahl zeigt, wie Missbrauch von Macht selten mit dem großen Knall beginnt.
„Das Hauptproblem, meint Charlotte rückblickend, war die Grenze zwischen Arbeit und Privatem, die für den Verleger einfach nicht existierte und die also auch für seine Assistentin nicht existieren durfte.“ Also Facetime aus der Hotelsuite, nächtliche Anrufe ohne Anlass mit Fragen wie „Haben Sie einen Freund?“, „Sind Sie verliebt?“ Und durch diese zufälligen Berührungen, die keine Zufälle sind. Kein Übergriff im strafrechtlichen Sinne, dafür eine permanente Kolonialisierung des Alltags.
Wie in allen Caroline-Wahl-Romanen geht es auch um Liebe: zur Musik, zum Meer. Und obligatorisch gibt es natürlich auch eine Romanze. Eine, die mich nicht überzeugt: Bo, „der starke Bär“, bleibt als Figur blass. Er besitzt weder Tiefenschärfe noch narrative Energie und dient eher als Projektionsfläche.
Ich habe selten so klar gelesen, wie Kolleginnen Komplizen sein können, indem sie nichts tun. Dass der Verlag die Hierarchisierung beschwört und gleichzeitig behauptet, sie „habe nichts zu bedeuten“, ist dabei der vielleicht ehrlichste Witz des Buches.
Zwischen Büro, unheimlicher Wohnung und gelegentlich der Villa des Verlegers verdichtet sich Charlottes Welt: „Innenleben: düster. Love Interest: weg. Irgendwelche sozialen Kontakte: nein.“ Sie arbeitet immer länger, sie schläft immer weniger, ihr Auge zuckt, ihre Hand wird taub – bis der Körper die Notbremse zieht. Und genau deshalb braucht es am Ende eine Außenstimme, weil innen alles taub geworden ist. „Als sie fertig war, sagte die Ärztin: Sie gehen da nie wieder hin.”
Die Sprache ist geprägt von einer Erzählinstanz, die den Text selbst kommentiert, Vorwegnahmen einstreut und die Handlung in endlose Schleifen treibt.
Das nicht-lineare Erzählen mit Vorgriffen und Korrekturen spiegelt Charlottes Zermürbung: kein klarer Verlauf, sondern ein Kreisen, bis die Kräfte schwinden. Mal kommentiert der Text seine eigene Dramaturgie, mal kündigt er Ereignisse an, die später eintreten: „Aber jetzt erst mal der Reihe nach. Allmählich Spannung aufbauen, ein bisschen mehr von Charlottes Innen- und Privatleben erzählen, ein paar Mitarbeiter vorstellen, das Haus errichten.“ Dieser selbstreflexive Ton macht den Text originell, manchmal auch fahrig. Das ist nicht immer elegant, aber sehr erhellend, weil es genau jene Schleifen im Kopf spiegelt, in denen Menschen kreisen, die zu lange in falschen Loyalitäten gefangen sind.
Wahl benennt Sexismus, ohne ihn mit hohem Anklageton zu melodramatisieren. Sie zeigt, wie banal das Ungeheuerliche sein kann. Es ist ein Roman über das, was wir uns selbst antun, wenn wir nur noch um Anerkennung kreisen. Und es ist – trotz all der bitteren Komik – eine Emanzipationsgeschichte: „Möglicherweise ist genau das auch der Kern von Charlottes nicht so einzigartiger Geschichte: die Befreiung aus dem Elternhaus und das Finden des Weges in ein selbstbestimmtes Leben.“
Ich habe das Buch mit wachsender Beklemmung gelesen – und mit dem Gefühl, dass Caroline Wahl eine Form gefunden hat, Macht nicht nur zu beschreiben, sondern spürbar zu machen. Durch die fast schon manische Genauigkeit der Details. Es ist ein Buch, das zeigt, wie normalisierte Grenzüberschreitungen wirken. Und wie befreiend es sein kann, wenn endlich jemand sagt: „Sie gehen da nie wieder hin.“
„Die Assistentin“ zwingt nicht zur Empörung, sie zwingt zur Positionierung. Und wenn es nur die ist, die die Ärztin uns vorspricht. Manchmal ist Literatur genau dazu da.
Die Assistentin, Caroline Wahl, 368 Seiten, Rowohlt Buchverlag, Hamburg 2025.
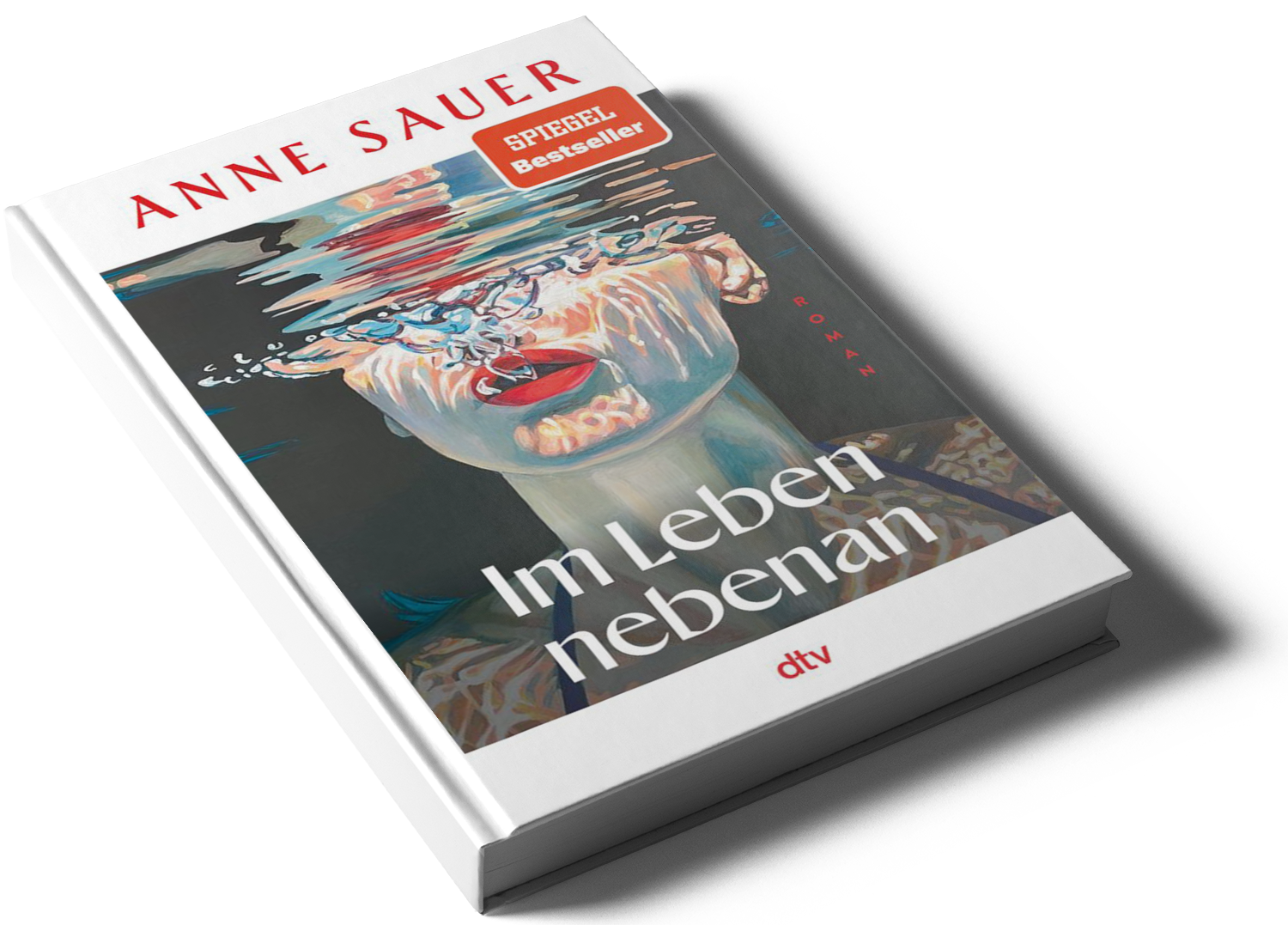
Buch des Monats
Im Leben nebenan
Anne Sauer porträtiert in ihrem Debütroman „Im Leben nebenan“ zwei Versionen der gleichen jungen Frau: Der einen wird die Entscheidung über das Kinderkriegen abgenommen, die andere beginnt, ihren Entschluss anzuzweifeln, Mutter zu werden. Egal, wie du dich entscheidest – es ist falsch.
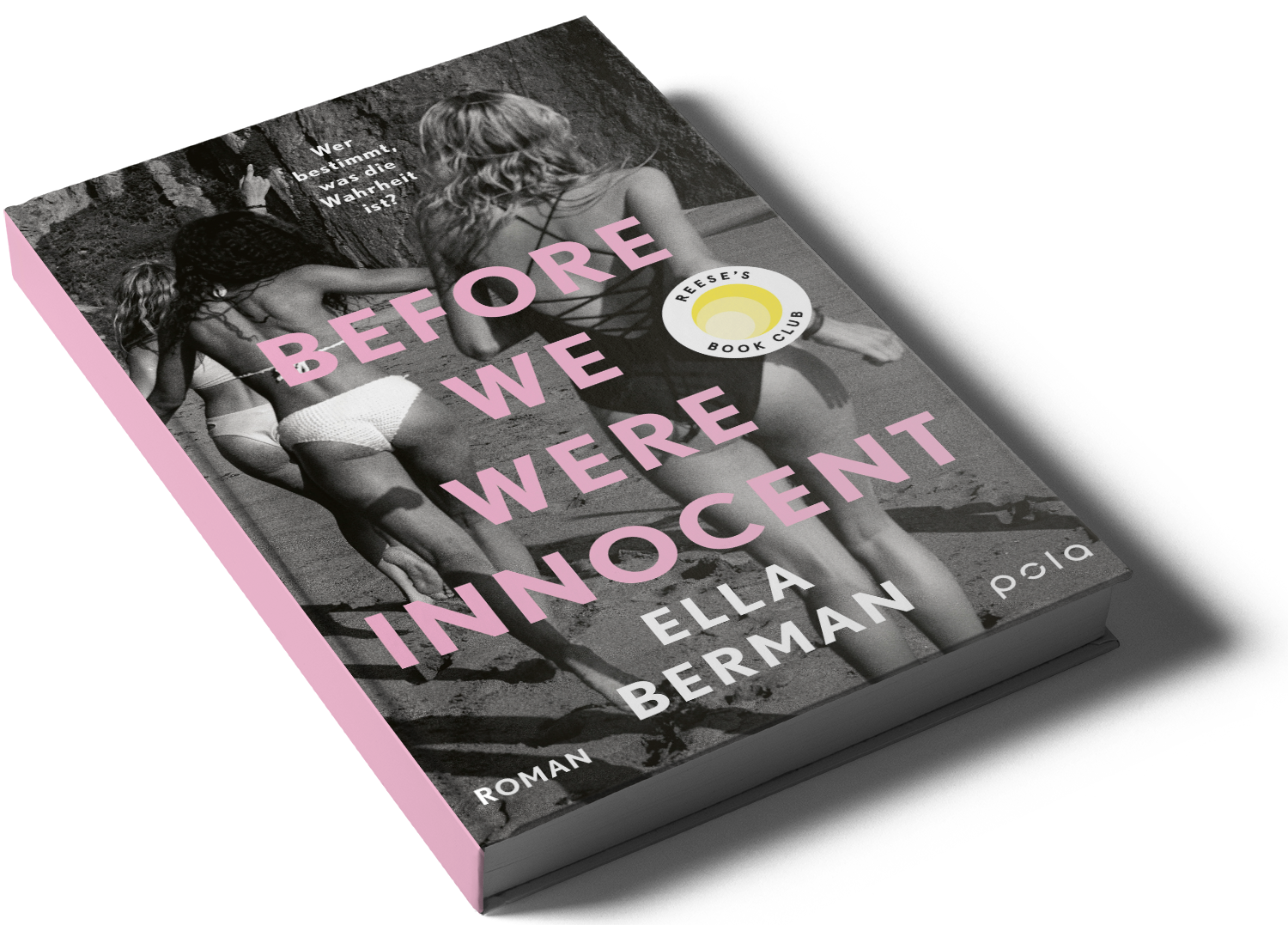
Buch des Monats
Before we were innocent
In „Before we were innocent“ erzählt Ella Berman nicht nur von einem Verbrechen, sondern vor allem davon, was danach bleibt – von Schuld, Schweigen und der Suche nach Wahrheit.
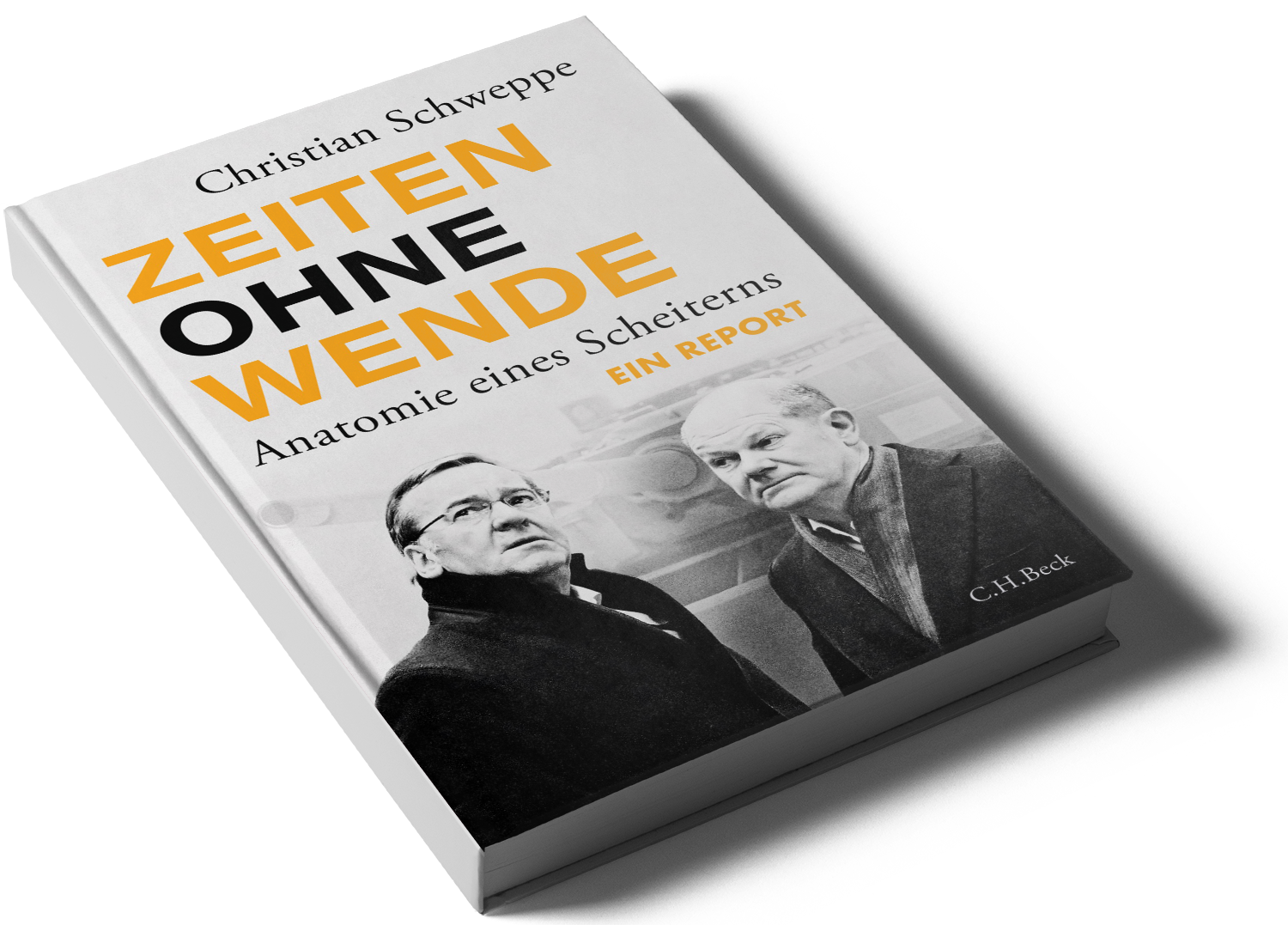
Buch des Monats
Zeiten ohne Wende
Christian Schweppe zeigt, warum Deutschlands sicherheitspolitische „Zeitenwende“ scheiterte – und was jetzt anders werden muss. Eine schonungslose Analyse, intensiver recherchiert und aktueller denn je.
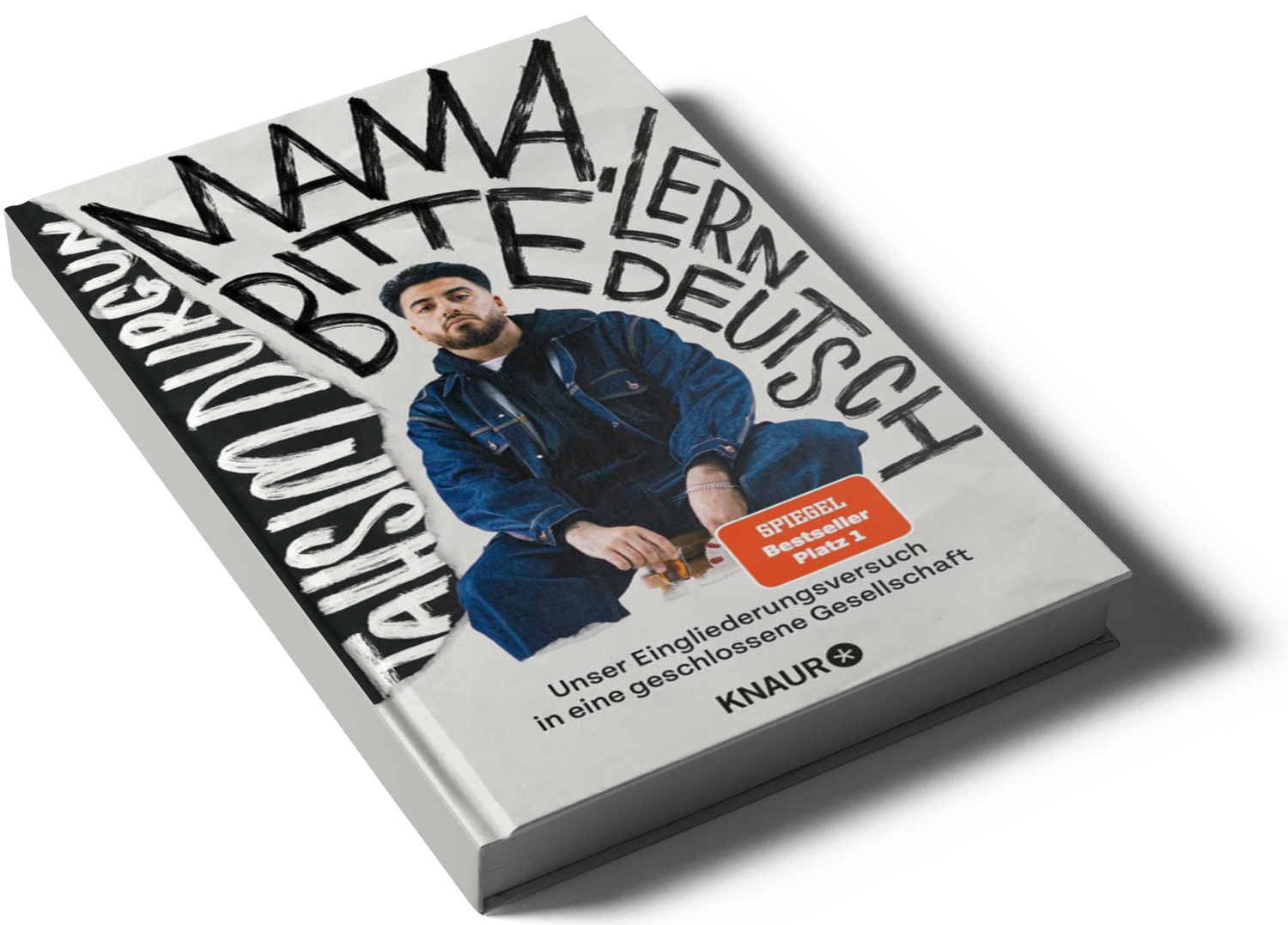
Buch des Monats
Mama, bitte lern Deutsch
Eigentlich hätte das Buch „Mama, bitte lern Deutsch“ von Tahsim Durguns Mutter geschrieben werden sollen – denn es ist ihre Geschichte.
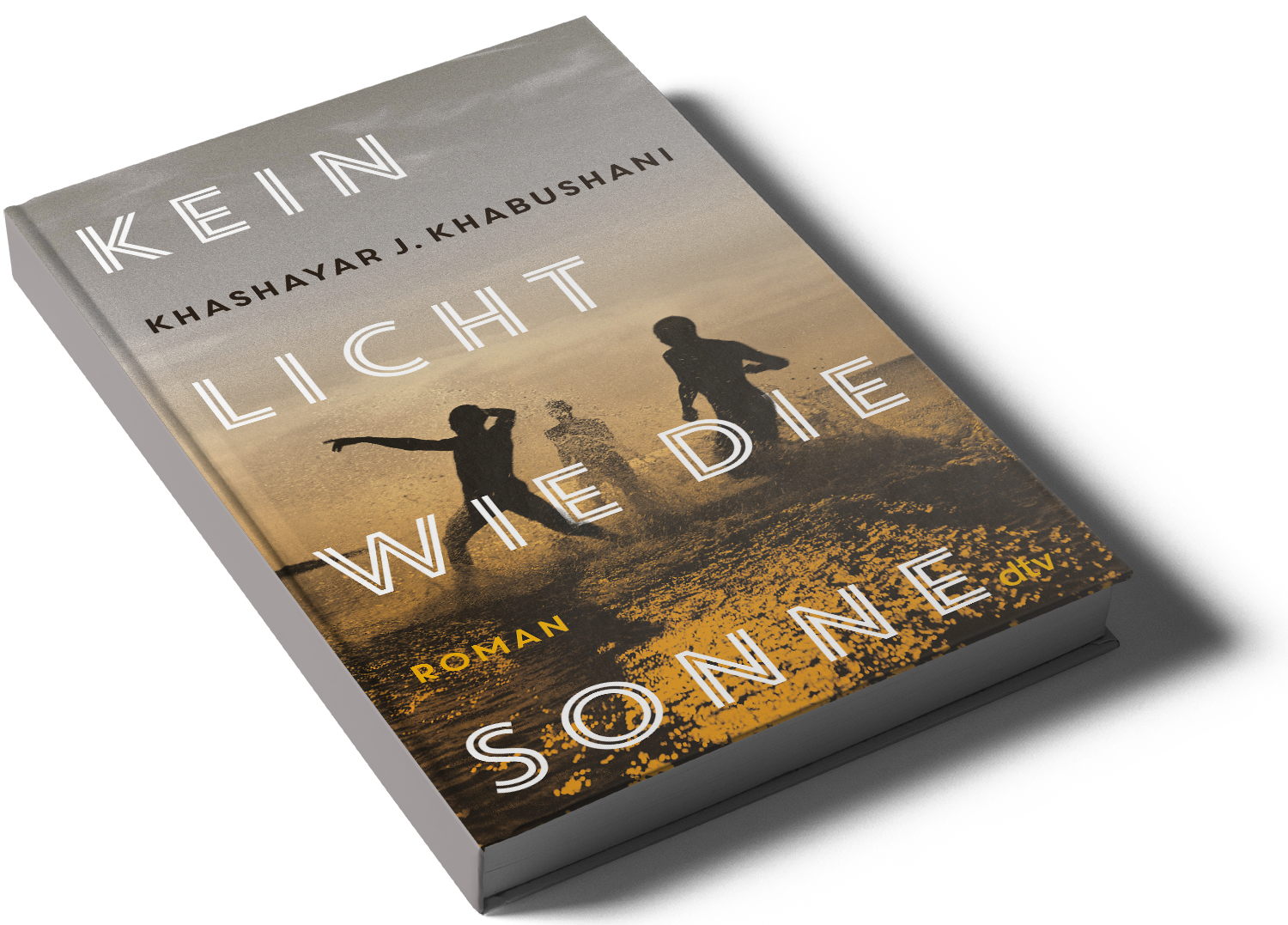
Buch des Monats
Kein Licht wie die Sonne
Was bedeutet es, zwischen zwei Welten zu leben – ohne in eine wirklich hineinzupassen? Khashayar J. Khabushanis Debütroman „Kein Licht wie Sonne“ erzählt von Identität, Zugehörigkeit und den Herausforderungen, seinen Platz in der Welt zu finden.
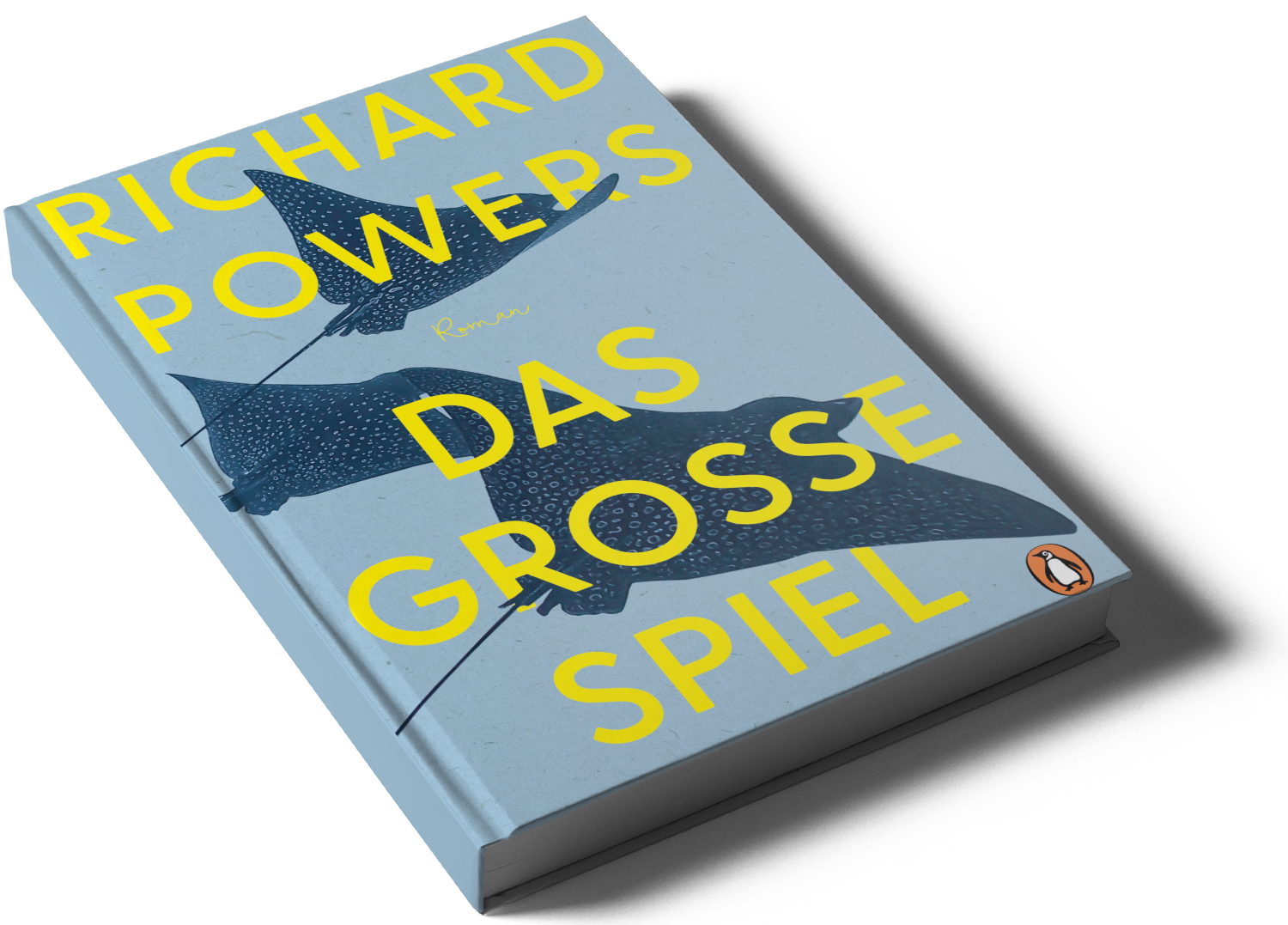
Buch des Monats
Das große Spiel
Wie man es schafft, mit einem Roman Hoffnung zu stiften in trostlosen Zeiten? Richard Powers fragen!
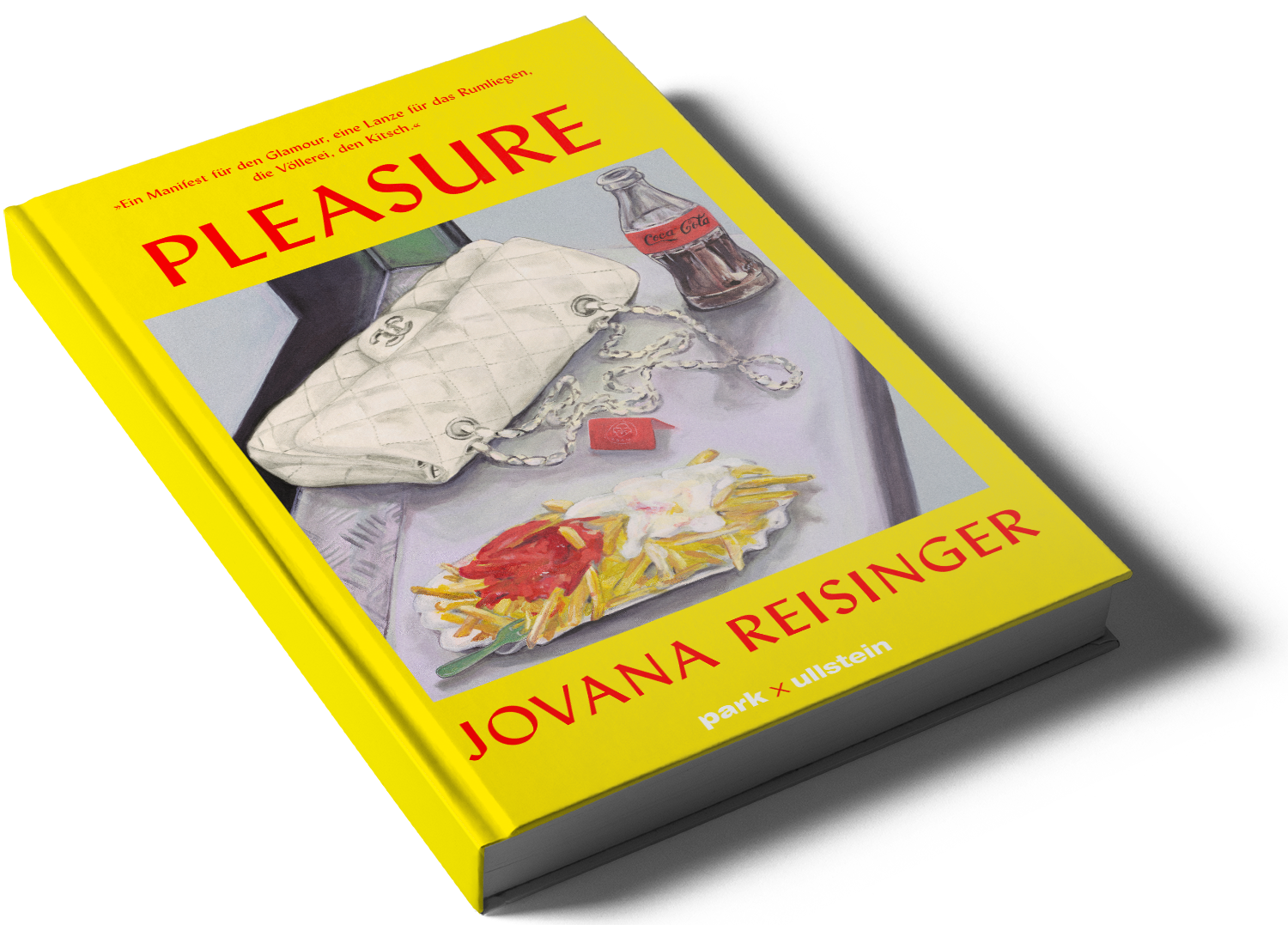
Buch des Monats
Pleasure
„Pleasure“ von Jovana Reisinger ist ein Buch, über das sich alle aufregen werden, die Glamour und Style für oberflächlich halten. Für mich ist es ein Manifest und die Aufforderung, mein Leben zu ändern.
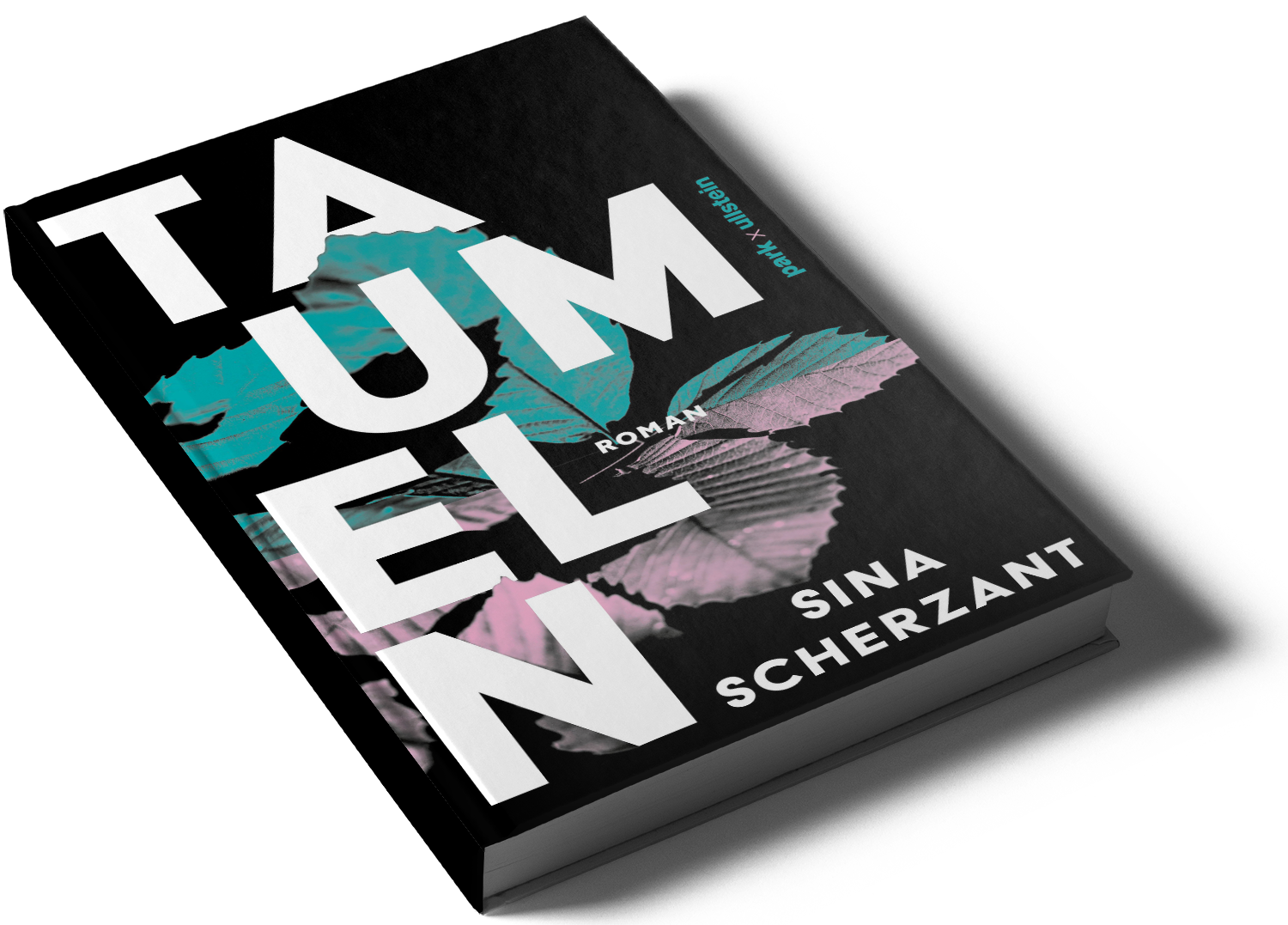
Buch des Monats
Taumeln
Sina Scherzant führt in ihrem Roman „Taumeln“ Suchende immer wieder in den Wald und uns zu Fragen, die wir uns lieber nicht stellen
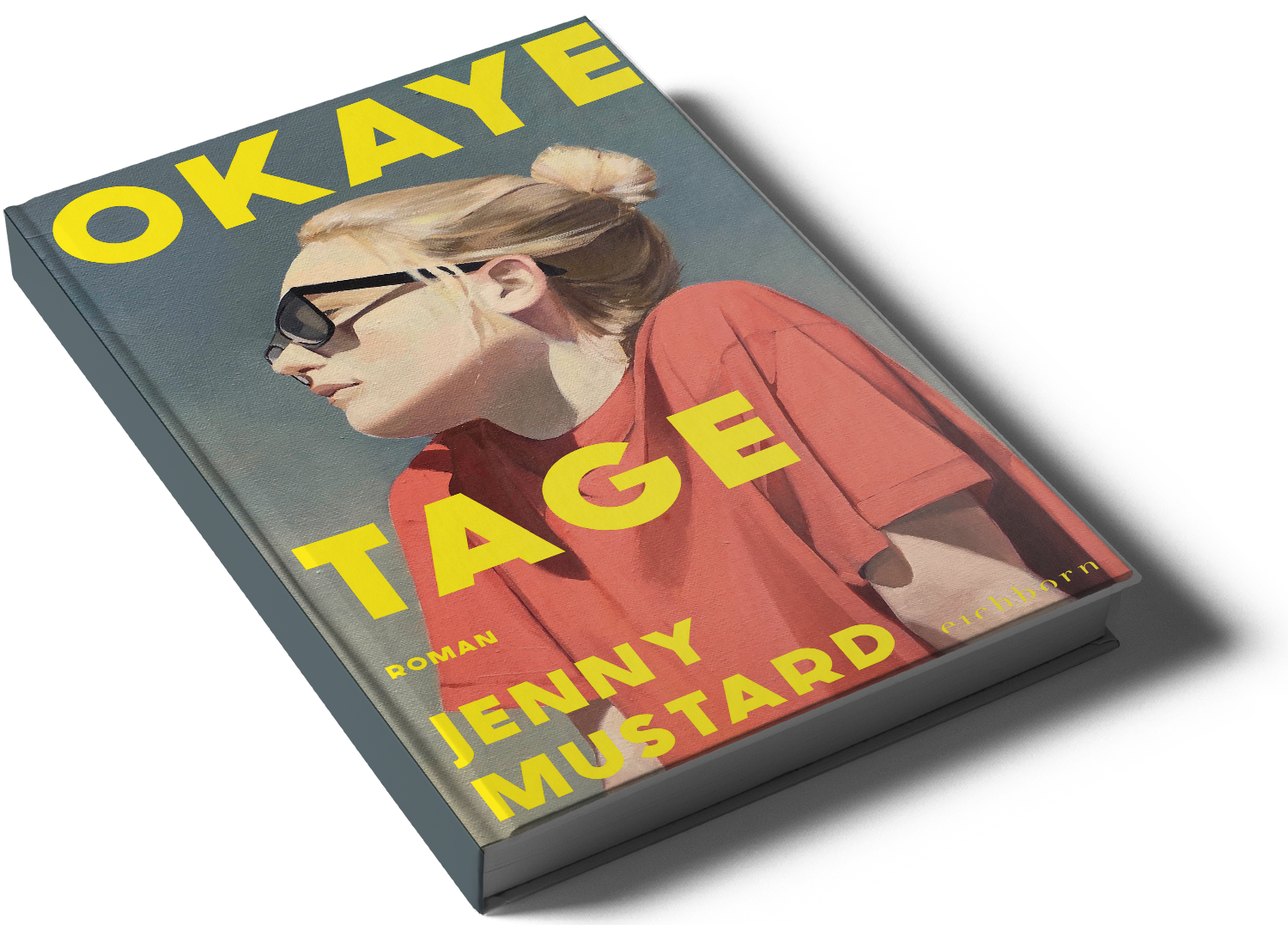
Buch des Monats
Okaye Tage
Einen Liebesroman, der realistisch, ohne Kitsch die Tiefen und Höhen des Verliebtseins zeigt. Kann es den geben?
